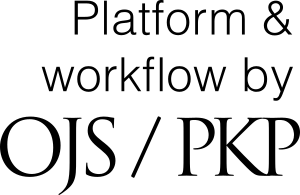Soziale Innovation oder sozial innovatives Handeln? Türkischstämmige Unternehmer/innen in Salzburg
DOI:
https://doi.org/10.63370/zfz.v5i1.79Schlagworte:
Soziale Innovationen,, Soziale Innovationen, soziale Entwicklung, gesellschaftliches Leitbild, ethnische Ökonomie,, genetischer Strukturalismus, migrantische Unternehmen,, sozial innovatives Handeln,, soziales Unternehmertum,Abstract
In Österreich werden sogenannte ethnische Ökonomien als soziale Innovation diskutiert. Der Beitrag geht der Frage nach, in welcher Weise migrantische Unternehmen – am Beispiel von türkischstämmigen Selbständigen in Salzburg – gesellschaftlichen Wandel begleiten und ob sie als soziale Innovationen bezeichnet werden können. Die Grundlage des Artikels bildet (1.) die Erörterung des Themenfeldes ethnische Ökonomie und migrantisches Unternehmertum, (2.) die Darstellung der Situation von türkischen Staatsbürger/innen in Bezug auf den Salzburger Arbeitsmarkt und (3.) die Einführung eines theoretischen Zugangs – den Genetischen Strukturalismus (Oevermann 1991) – als Modell für die Entstehung von Neuem in der Gesellschaft. Die Vorstellung dieses Zugangs wird durch Fallbeispiele türkischstämmiger Selbständiger in Salzburg illustriert. Es kann gezeigt werden, dass die Gruppe der Türk/innen in Salzburg eine benachteiligte Position am Arbeitsmarkt einnimmt, die mitunter auf Diskriminierung zurückzuführen ist und die als soziales Problem bezeichnet werden kann. Die von türkischstämmigen Personen geführten Unternehmen können zwar als sozial innovativ, aber nur begrenzt als soziale Innovation bezeichnet werden: Sie sind in der Lage, Benachteiligungen beizukommen, reagieren aber nicht zielgerichtet und abgestimmt auf die Problematik.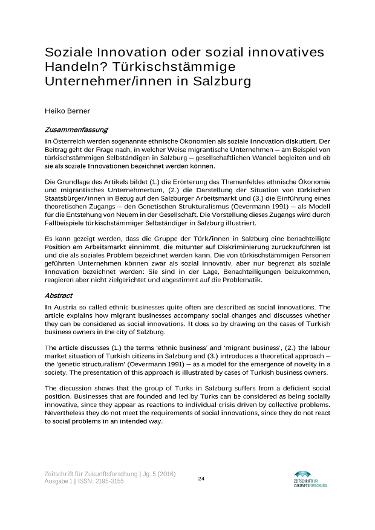
Veröffentlicht
21.12.2016
Ausgabe
Rubrik
Beiträge
URN
Lizenz
Copyright (c) 2016 Heiko BernerUrheberrechte
Die in der Zeitschrift für Zukunftsforschung veröffentlichten Artikel unterliegen der Digital Peer Publishing Lizenz (DPPL), in der u.a. die Rechte der Autorinnen und Autoren , der Zeitschrift für Zukunftsforschung sowie der Leserinnen und Leser geregelt sind. Zentrales Anliegen dieser Lizenz ist die konsequente Umsetzung des Open Access Ansatzes. Dabei verbleiben die Rechte für die Nutzung der eingereichten Artikel in Druckform oder auf Trägermedien bei dem Autor/der Autorin. Die für die Veröffentlichung in der Zeitschrift für Zukunftsforschung verbindliche DPPL v3.0 kann hier heruntergeladen werden.